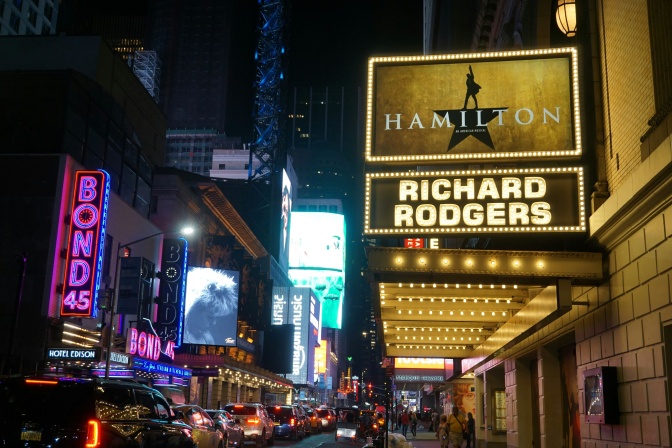Samuel Koch hatte einen Unfall im Hotel
Samuel Koch ist Schauspieler.
Er ist 38 Jahre alt.
So sieht er aus:
Samuel Koch war in einem Wellness-Hotel in Österreich.
Dort hatte er einen Unfall.
Samuel Koch erzählt:
"Es war der Klassiker.
Ich bin in der Dusche ausgerutscht.
Die Details will ich euch ersparen."
Samuel Koch ist mit dem Gesicht auf den Boden gefallen.
Dabei hat er sich die Nase gebrochen.
Und er hat Prellungen im Gesicht.
Samuel Koch arbeitet für die Münchner Kammerspiele.
Das ist ein bekanntes Theater in München.
Wegen des Unfalls konnte er dort nicht auftreten.
Er sagt:
"Es tat mir furchtbar leid für die Zuschauer.
Ich hoffe, sie kommen wieder."
Star-Lexikon
Wer ist Samuel Koch?
Er ist Schauspieler.
Er spielt Theater.
Zum Beispiel bei den Münchner Kammer·spielen.
Als Kind war Samuel Koch Turner.
Er hat Geräte·turnen gemacht.
Nach der Schule hat Samuel Koch eine Ausbildung als Schauspieler angefangen.
Dann hatte er einen schweren Unfall.
Er hat bei der Sendung "Wetten dass...!?" mit·gemacht.
Er wollte mit einem Salto über 5 Autos springen.
[Ein Salto ist ein Über·schlag in der Luft.]
Dabei ist er gestürzt und hat sich schwer verletzt.
Seit·dem ist Samuel Koch querschnitts·gelähmt.
Das heißt:
Er kann nicht mehr laufen.
Er braucht jetzt einen Roll·stuhl.
Samuel Koch hat auch in Filmen und Fernseh·sendungen mit·gespielt.
Zum Beispiel in der Serie "Sturm der Liebe".
Und im Film "Honig im Kopf".
Samuel Koch ist verheiratet.
Seine Frau heißt Sarah Elena Timpe.
Sie ist auch Schauspielerin.
Bald bekommen die beiden ein Baby zusammen.
Samuel Koch hat 3 Bücher geschrieben:
- Samuel Koch – 2 Leben
- Rolle vorwärts – Das Leben geht weiter, als man denkt
- Steh auf Mensch! Was macht uns stark? (K)ein Resilienz-Ratgeber